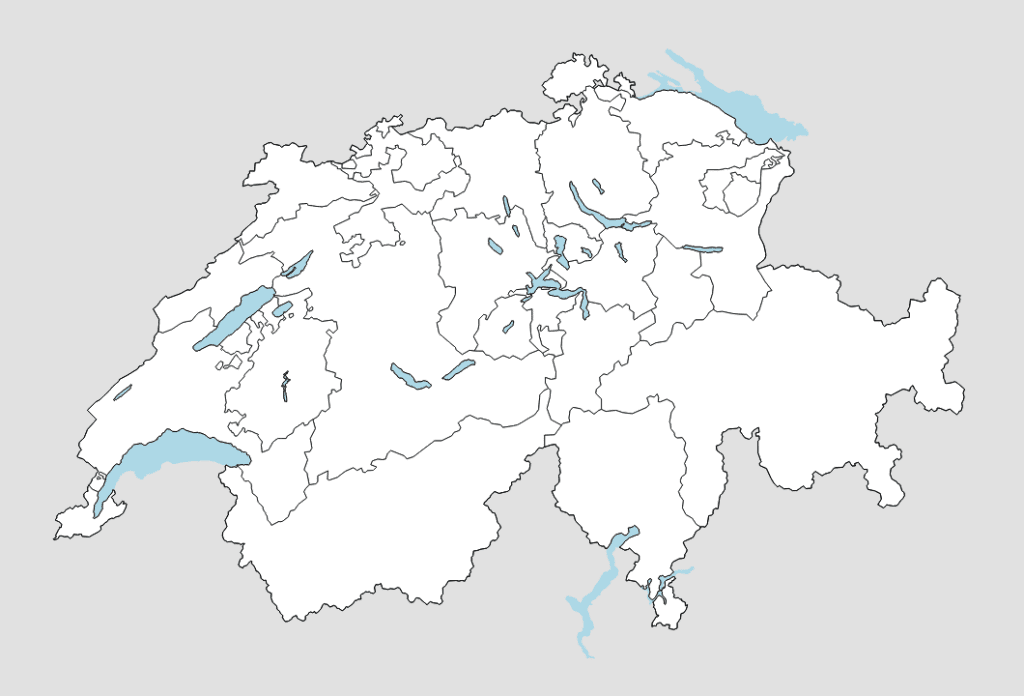Tages-Anzeiger vom Mi, 14.05.2025,
https://epaper.tagesanzeiger.ch/article/20/20/2025-05-14/4/135433154
Wer sein Haus verschenkt, soll keine Sozialhilfe mehr erhalten
Abstimmung in Uri Der Kanton plant strengere Gesetze gegen Sozialhilfemissbrauch. Er will etwa die Leistungen kürzen, wenn Bedürftige zu viel Vermögen ausgegeben oder verschenkt haben.
Markus Brotschi
Der Kanton Uri hat eine der tiefsten Sozialhilfequoten der Schweiz: Nur 1,1 Prozent oder rund 400 der 38’000 Einwohnerinnen und Einwohner beziehen Sozialhilfe. Zum Vergleich: Gesamtschweizerisch beträgt die Quote 2,8 Prozent.
Dennoch stimmt die Urner Bevölkerung am 18. Mai über eine Verschärfung des Sozialhilfegesetzes ab. So sollen künftig Sozialdetektive eingesetzt werden können, um Missbräuche aufzudecken. Besonders brisant ist jedoch eine Regelung, mit der Bedürftigen im Extremfall die Sozialhilfe ganz verweigert werden soll.
Wer in den zehn Jahren vor dem Antrag auf Sozialhilfe sein Vermögen verschenkt oder übermässig abgebaut hat, muss mit einer Kürzung der Sozialhilfe rechnen. Die Sozialbehörde berechnet den Hilfsanspruch dann so, als wäre das verschenkte oder zu viel verbrauchte Vermögen noch vorhanden. Eine solche Regelung gibt es bereits bei den Ergänzungsleistungen (EL), wo ein sogenannter Vermögensverzicht zu Leistungskürzungen führt.
Statt Sozialhilfe bloss 10 Franken pro Tag
Die Urner Regierung und die Mehrheit im Parlament begründen die neue Regelung mit Missbräuchen. Es habe in der Vergangenheit einzelne Fälle gegeben, in denen ein Haus an die Kinder übertragen worden sei, sagt Sozialdirektor Christian Arnold (SVP). Später hätten die Eltern Sozialhilfe für den Heimaufenthalt benötigt. «Es kann nicht sein, dass die Allgemeinheit in solchen Fällen für die Sozialhilfe aufkommen muss», sagt Arnold. Wer von der Sozialhilfe ausgeschlossen sei, habe aber immer noch Anrecht auf Nothilfe.
Diese beläuft sich allerdings bloss auf rund 10 Franken pro Tag und wird vor allem an abgewiesene Asylsuchende ausgerichtet, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Die Gegner des neuen Urner Sozialhilfegesetzes halten die Bestimmung zum Vermögensverzicht jedoch für verfassungswidrig. Die Bundesverfassung garantiere bei Notlagen das Recht auf ein menschenwürdiges Leben, sagt Jonas Bissig, Co-Präsident der Urner SP. Wenn die Sozialhilfe auf das Niveau von Sackgeld gekürzt werde, verstosse das gegen die Menschenwürde.
SP erwägt eine Klage vor Bundesgericht
Die Gegner kritisieren eine Misstrauenskultur, die mit dem Gesetz Einzug halte. So können die Behörden künftig Sozialdetektive engagieren, um Missbräuche aufzudecken. Zwar gibt es solche Detektive bereits in anderen Kantonen. Im kleinen Kanton Uri sei die soziale Kontrolle aber gross und Sozialhilfeempfänger entsprechend stigmatisiert, sagt Bissig. Das Missbrauchspotenzial sei wegen der fehlenden Anonymität gering.
Gegen das neue Sozialhilfegesetz sind SP, Grüne und GLP. Den Anstoss zu einer umfassenden Reform gab eine Motion eines MitteParlamentariers. Bissig hofft, dass die Bevölkerung das Sozialhilfegesetz ablehnt, kennt aber auch die verbreitete Meinung zu Sozialhilfebezügern. «Viele denken, dass sie selber nie auf Sozialhilfe angewiesen sind, sondern in erster Linie Leute, die nicht arbeiten wollen.» Die Realität sehe jedoch anders aus, sagt Bissig. Ein grosser Teil der Beziehenden im Kanton seien Working Poor und Alleinerziehende sowie Kinder und Jugendliche.
Die SP überlegt sich bei einer Annahme des Gesetzes, die Anwendung des Vermögensverzichts vor Bundesgericht anzufechten. Dafür braucht es allerdings zuerst einen konkreten Fall, in dem im Kanton Uri die Sozialhilfe wegen eines Vermögensverzichts gekürzt wird.
Die neue Regelung sei eine Falle für Familien, sagt Bissig. So könne etwa eine Schenkung an ein Enkelkind oder die Finanzierung einer Weiterbildung später zu Kürzungen bei der Sozial- hilfe führen. Gegen Missbräuche hätten die Sozialdienste bereits heute eine Handhabe. Zudem könne bei der Übertragung des Eigenheims oder eines grösseren Vermögens auf Verwandtenunterstützung zurückgegriffen werden. Die Sozialhilfebehörde kann beispielsweise erwachsene Kinder dazu verpflichten, die Eltern zu unterstützen. Allerdings gilt diese Unterstützungspflicht nur, wenn nahe Verwandte in guten Verhältnissen leben.
Urner Sozialdirektor hofft auf die präventive Wirkung
Sozialdirektor Arnold hofft hingegen, dass die neue Regelung präventive Wirkung hat, dass also niemand mehr Vermögenswerte verschenkt, im Wissen darum, später auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. Wie genau die neue Missbrauchsregel angewandt wird und welche Beträge als Vermögensverzicht gewertet werden, muss das Urner Parlament noch in einer Verordnung festlegen. Bedürftige müssten aber auch künftig nicht auf der Strasse leben, sagt Arnold.
Gerade bei Pflegeheimaufenthalten stellt sich jedoch die Frage, wer für die Kosten bei einer Kürzung der Sozialhilfe aufkommt. Denn wer im Pflegeheim auf Sozialhilfe angewiesen ist, hat unter Umständen bereits eine Kürzung der Ergänzungsleistungen hinnehmen müssen. Diese decken in vielen Fällen die Heimkosten, wenn das Renteneinkommen nicht ausreicht. Bereits seit 2021 werden aber die EL gekürzt, wenn Rentnerinnen und Rentner früher auf Vermögen verzichtet haben, also ein Haus verschenkt oder einen zu grossen Teil ihres Vermögens verbraucht haben.
In den eidgenössischen Räten wurde bei der Reform darauf verwiesen, dass bei einer Kürzung der EL immer noch die Sozialhilfe als letztes Sicherungsnetz vorhanden sei. Wenn nun die Sozialhilfe ebenfalls nicht mehr zahlen würde, dürften am Schluss die Pflegeheime auf den Kosten sitzen bleiben. Bei Menschen, die zu Hause leben, stellt sich die Frage, wer beispielsweise für die Wohnung aufkommt.
Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos), an deren Richtlinien sich die meisten Kantone orientieren, hält die generelle Anrechnung des Vermögensverzichts «in der Praxis für nicht umsetzbar», weil dies nicht mit dem verfassungsmässigen Recht auf Hilfe in Notlagen vereinbar sei. Anders als bei Sozialversicherungen dürften Leistungen der Sozialhilfe nicht von den Ursachen einer Notlage abhängig gemacht werden, schreibt die Skos.
Problem auf Alters- und Pflegeheime übertragen?
Seit bei den EL der Vermögensverzicht und der Vermögensverbrauch berücksichtigt würden, habe die Zahl der über 65-Jährigen zugenommen, die von der Sozialhilfe unterstützt würden. Werde dieses Prinzip auch noch bei der Sozialhilfe eingeführt, führe dies zu «menschenunwürdigen Situationen» und übertrage das Finanzierungsproblem auf Alters- und Pflegeheime.
Sorgen bereitet der Skos, dass auch grosse Kantone ähnliche Regelungen planen. So schlägt die Berner Regierung eine Bestimmung zum Vermögensverzicht im Sozialhilfegesetz vor. Luzern kennt bereits eine solche Regelung.
© Tagesanzeiger. Alle Rechte vorbehalten